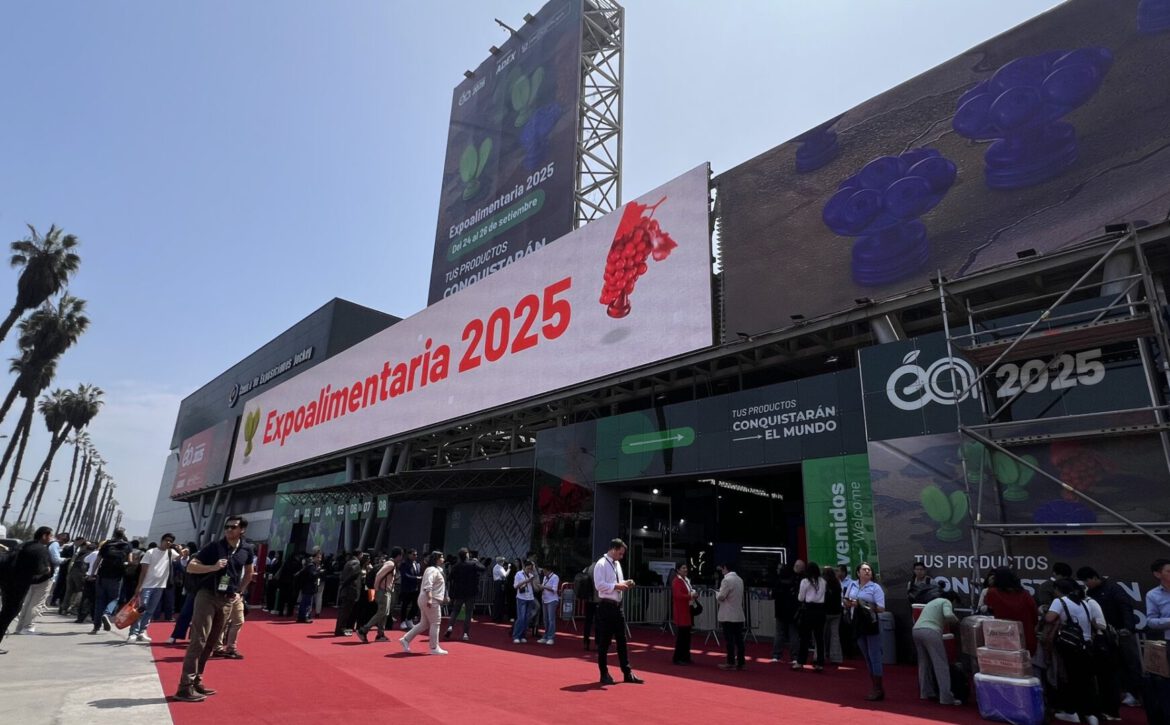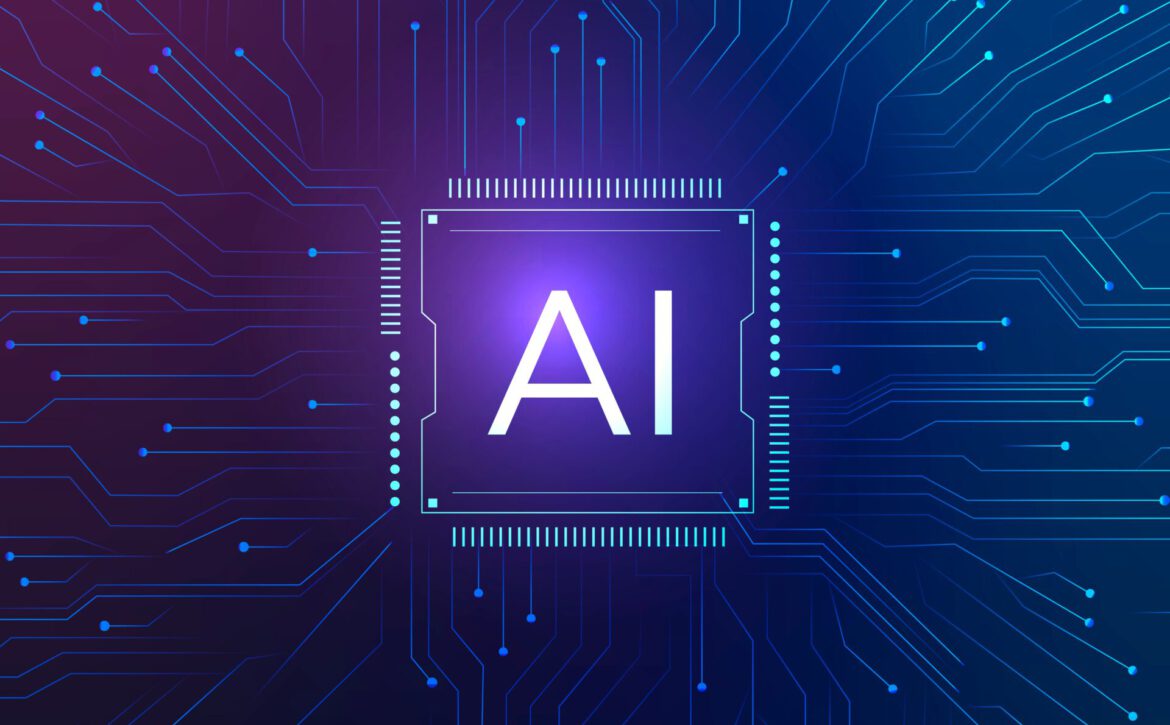Unternehmensgründung und Marken- und Patentanmeldung in Deutschland
Unternehmensgründung und Marken- und Patentanmeldung in Deutschland
Für Entrepreneure sind Firmengründung und Schutz geistigen Eigentums eng verknüpft: guter Rechtsschutz (Marke / Patent) sichert Marktchancen; die richtige Unternehmensform minimiert Haftungsrisiken. Die folgenden Anleitungen erleichtern dir beides — praktisch, mit Formulartipps und Kostenhinweisen.
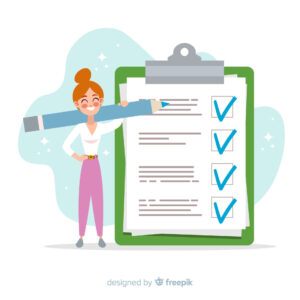
Bild beim Freepik
7 praktische Schritte zur Unternehmensgründung
- Rechtsform wählen: Zuerst muss man zwischen Einzelunternehmen, GbR, UG (haftungsbeschränkt), GmbH oder AG wählen. Die Wahl beeinflusst Haftung, Steuern und Finanzierungsmöglichkeiten, deswegen muss man auf Haftung, Startkapital und steuerliche Belastung achten. Beispiele: Einzelunternehmen (ab 20 € Anmeldung), UG (ab 1 € Stammkapital, Notar + Register ab ca. 400-600 €), GmbH (25.000 € Stamkapital, Notar + Register ca. 600-950 €)
- Firmen prüfen: Vermeide Verwechslungen mit bestehenden Marken oder Firmen (Recherche im DPMAregister oder im Handelsregister).
- Gewerbe anmelden beim zuständigen Gewerbeamt: Die Anmeldung startet automatisch Meldevorgänge zu Finanzamt, Berufsgenossenschaft und ggf. Amtsgericht/Handelsregister (Existenzgründungsportal). Kosten: zwischen 20–60 €, je nach Gemeinde.
- Notar & Handelsregister: Bei Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, UG oder AG) werden Gesellschaftervertrag/Notarbestätigung benötigt; Eintragung ins Handelsregister ist Pflicht. (Notar beglaubigt Unterschriften, Eintragung erfolgt beim Registergericht). Beispiele: Notarkosten je nach Umfang: ab 300 € (UG) bis 800 € (GmbH), Handelsregistereintrag: ca. 150-200 €.
- Finanzamt & Steuernummer: Nach der Gewerbeanmeldung erhältst du Post vom Finanzamt (Steuerfragebogen, ggf. Umsatzsteuer-ID). Du kannst den steuerlichen Erfassungsbogen online ausfüllen und bei Bedarf den USt-ID beantragen (kostenlos).
- Industrie- und Handelskammer (IHK) / Handwerkskammer (HWK) / Versicherungen: Pflichtmitgliedschaft in IHK oder HWK je nach Tätigkeit. Außerdem Krankenversicherung, Berufsgenossenschaft und ggf. Sozialversicherung für Mitarbeiter. Beispiele: Krankenversicherung (gesetzlich ab ca. 200 €/Monat als Selbstständiger), Berufsgenossenschaft für Unfallversicherung.
- Geschäftskonto & Buchführung: Geschäftskonto bei einer Bank eröffnen, Buchhaltung organisieren (bei Kapitalgesellschaften doppelte Buchführung) und ggf. Steuerberater beauftragen. Beispiele: Steuerberater ab 50-100 € / Monat, abhängig vom Aufwand

Bild beim Freepik
8 Praktische Schritte zur Markenanmeldung und Patentanmeldungen
Markenanmeldung:
- Recherche nach bestehenden Marken: Vor der Anmeldung prüfen, ob identische oder ähnliche Marken bereits eingetragen sind (DPMAregister, TMview, EUIPO, WIPO u.ä.). Eine gründliche Recherche reduziert das Risiko von Widersprüchen oder Zurückweisung.
- Marke und Waren-/Dienstleistungsklassen festlegen: Entscheide, ob es sich um eine Wortmarke, Bildmarke, Wort-Bildmarke, 3D-Marke, Farbmarke oder Klangmarke handelt. Erstelle zudem eine Liste der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke geschützt werden soll (Klassifikation von Nizza, 45 Klassen).
- Anmeldung beim DPMA einreichen:
Markenanmeldung beim DPMA erfolgt elektronisch (empfohlen, schneller und günstiger) durch DPMA direktWeb oder DPMA direktPro, oder schriftlich. Notwendige Angaben: Anmelder, Darstellung der Marke, Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen.Kosten: Elektronische Anmeldung: ab 290 € (bis zu 3 Klassen), Papierform: ab 300 € (bis zu 3 Klassen), Jede weitere Klasse: +100 € - Formale Prüfung durch das DPMA: Das DPMA prüft, ob die Anmeldung vollständig ist und ob absolute Schutzhindernisse vorliegen (z. B. fehlende Unterscheidungskraft, beschreibende Angaben).
- Veröffentlichung & Widerspruchsfrist: Wird die Marke nicht beanstandet, erfolgt die Veröffentlichung im Markenblatt. Innerhalb von 3 Monaten können Dritte Widerspruch einlegen, falls ältere Rechte verletzt werden.
Kosten für einen Widerspruch: ab 250 € (für die erste Widerspruchsmarke, weitere +50 €). - Gebühren & Zahlungsfristen: Die Anmeldegebühr muss rechtzeitig gezahlt werden, sonst gilt die Anmeldung als zurückgenommen.
Gebührenübersicht (Stand 2025): Elektronische Anmeldung: 290 €, Zusätzliche Klassen: je 100 €, Verlängerung nach 10 Jahren: ab 750 € (für bis zu 3 Klassen, jede weitere Klasse +260 €). Quelle: Markengebühren - Eintragung & Markenschutz: Nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach erfolgreicher Abwehr eines Widerspruchs trägt das DPMA die Marke ins Register ein. Ab diesem Zeitpunkt genießt der Anmelder Markenschutz (zunächst 10 Jahre, rückwirkend ab dem Anmeldetag). Quelle: Markenregister – DPMA
- Aufrechterhaltung & Verlängerung: Der Markenschutz kann beliebig oft um weitere 10 Jahre verlängert werden – dazu ist die Verlängerungsgebühr fristgerecht zu entrichten.
Wichtig: Wird die Marke fünf Jahre nicht ernsthaft benutzt, kann sie wegen Nichtbenutzung gelöscht werden. Mehr Information: Verlängerung

Bild beim Freeepik
Patentanmeldung
- Recherche zum Stand der Technik: Recherchiere vorhandene Patente und Veröffentlichungen (DPMA-Register, Espacenet u.ä.) – das reduziert Risiko von Ablehnung.
- Erfindung dokumentieren: Vollständige Beschreibung mit technischer Lösung, Zeichnungen, Patentansprüchen klar formulieren. Tipp: Professionelle Patentanwälte helfen, typische Fehler zu vermeiden.
- Anmeldung beim DPMA einreichen: Patentanmeldung beim DPMA (schriftlich oder elektronisch). Die DPMA-Website enthält alle Hinweise zur Anmeldung und Formularen. Patentanmeldung. Kosten: Elektronisch ab 60 € (Formular P 2792), Papierform 70€
- Rechercheantrag (amtliche Recherche, optionale): Empfehlenswert, denn die amtliche Recherche macht relevanten Stand der Technik sichtbar (Gebühr separat). DPMA erstellt Bericht zum relevanten Stand der Technik. Kosten: 300 €.
- Prüfungsantrag stellen: Nur mit diesem Antrag prüft das DPMA die Patentfähigkeit (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit). Der Prüfungsantrag muss spätestens binnen der im Gesetz genannten Frist gestellt werden. Merkblatt für Patenanmelder. Gebühr: 350 €
- Gebühren & Zahlungsfristen: Anmeldegebühr, Recherche- und Prüfungsgebühr sowie später Jahresgebühren müssen fristgerecht bezahlt werden. Gebühren für Patentschutz. Beispielgebühren (Orientierung): Anmeldegebühr elektronisch 40 €, Recherche 300 €, Prüfungsgebühr (je nach Vorliegen der Recherche) 150 € / 350 €; Jahresgebühren beginnen ab Jahr 3, 70 €, danach steigend (20. Jahr: ca. 2.030 €).
- Verfahren & Korrespondenz: Nach der Recherche/Prüfung folgen ggf. Beanstandungen vom Prüfer — hier antwortet der Anmelder, passt Ansprüche an oder argumentiert. Dauer: oft mehrere Jahre (ca. 2–3 Jahre).
- Erteilung & Aufrechterhaltung: Wird das Patent erteilt, ist es geschützt (max. Laufzeit 20 Jahre ab Anmeldetag) — dafür müssen jährlich Gebühren gezahlt werden; Dritte können Einspruch erheben (innerhalb 9 Monate möglich).
Beschleunigungsmöglichkeiten: Es gibt Möglichkeiten, die Prüfung vorrangig zu bearbeiten (z. B. durch PPH/GPPH-Vereinbarungen), wenn eine positive Entscheidung eines anderen Partneramtes vorliegt; Einzelheiten dazu erfahren Sie beim DPMA. Patent Prosecution.

Bild beim Freepik
Geschrieben von Mónica Valcárcel
Beitragsbild by Freepik